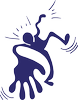Reisebericht Westindische Karibikinseln
St. Lucia
St. Lucia produziert hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte, lebt von der Fischerei und natürlich vom Tourismus. Gerade der Tourismus verändert St. Lucia sehr stark. So gibt es sehr feudale Hotelanlagen, nebst sehr bescheidenen Häusern der Einheimischen. Hier gibt es einen grossen Luxus bei manchen Einheimischen, wie auch Armut. St. Lucia gilt mit Grenada als die schönste der Insel der Antillen. Sie ist sehr grün, mit hohen, steilen Berggipfeln, steil abfallend zu palmengesäumten Stränden. Das Klima ist tropisch mit einem kühlenden Passatwind.
Eigentlich wäre jetzt Trockenzeit, doch es giesst jeden Tag mehrere Male wie aus Kübeln. Das heisst für mich jedesmal, die aufgehängte Wäsche ins Trockene zu bringen und eine Stunde später wieder aufhängen, bzw. fortlaufend die trockenen Wäschestücke abhängen, Luken schliessen, Luken öffnen, etc. Nach unserer langen Reise vom letzten Hafen auf den Kanarischen Inseln bleiben wir vorläufig hier im Norden der Insel in Rodney Bay liegen. Es gibt es viel zu waschen, reinigen, überholen und reparieren. Im Schiff ist so etwas wie ein grosser Frühlingsputz im Gange und wir warten auf die Ersatzteile für unseren Autopilot aus der Schweiz.
Täglich geniessen wir mit unseren Leichtmatrosen einen kühlenden Sprung in das smaragdgrüne Meer. Wir erfahren, dass noch vor kurzem dieser Strand ganz anders ausgesehen habe. Im Dezember 1999 fegte Hurrican „Lenny“ über die Karibik. Normalerweise entstehen Hurricane im Atlantik und erreichen die Karibikinseln auf der atlantischen Seite, Lenny aber entstand aussergewöhnlicherweise im karibischen Meer und hat riesige Schäden angerichtet. Ganze Strände sind verschwunden oder verändert, wunderschöne Riffe zerstört, Hotelanlagen wurden zu Trümmerhaufen, u.s.w.
Wir leben uns gut ein und finden heraus, wie man mit den kleinen, rasenden Bussen in die Hauptsstadt Castries mitfahren kann. Vor allem in St. Lucia ist man sehr gut beraten, wenn man vor Antritt irgend einer Fahrt, ob Taxi oder Bus, ungefähr Bescheid weiss über die üblichen Fahrpreise, sonst bezahlt man leicht mehr als das Doppelte.
Die Waren in den Supermärkten sind fast so teuer wie in der Schweiz, leider aber in der Auswahl und Qualität nicht sehr gut. Da wir inzwischen wissen, dass es in Martinique eine grosse Auswahl an französischen Produkten zu günstigen Preisen habe und unsere Atlantikmitsegler „Hööloplopp“ und „Schoggelgaul“ dort vor Anker liegen, beschliessen wir spontan einen zweitägigen kurzen Abstecher zu machen. Schliesslich liegen die Inseln in Sichtweite zueinander und bei gutem Wind ist es nur ein ca. 7 stündiger Törn.
Aus unserem geplanten 2-tägigen Aufenthalt in Martinique wurde schliesslich im Nu 1 Woche.
Martinique
Martinique Ist ein Überseedepartement von Frankreich. Auf Martinique wird französisch und Créole (Patois) gesprochen, mit französischen Francs bezahlt, französiche Menus gegessen, aber immer mit karibischen Charme gekocht und serviert.
Nach einem kleinen Abstecher in der ruhigen Bucht Grand Anse D’Arlet sind wir schnell im Hauptort Fort de France. Hier lässt sich die Muscat wieder mit Lebensmittel bunkern! Preislich wie in Europa, d.h. günstiger als in den anderen Westindischen Staaten und mit einer grossen Auswahl in den Supermärkten!! Camembert, Appenzeller, Brie und noch mehr, Brote, Weine, Bier, alles zu schlemmen in riesiger Auswahl und zu angemessenen Preisen. In den Markthallen werden alle möglichen feinen Gewürze, Eingemachtes und Handarbeiten, wie auch Frischfisch und Fleisch angeboten.
Martinique zu Lande
Zwar lässt es sich mit dem Schiff, die schönsten und einsamsten Strände erreichen, doch das Landesinnere erkundigen wir am besten mit den einheimischen Bussen. Mit einem kleinen Linienbus (Maxi Taxi) fahren wir, zusammen mit Uschi und Günther von der Schoggelgaul nach Morne Rouge auf 800 m Höhe mit Weitsicht und auf den noch aktiven Vulkan Mt. Pelé, der sich allerdings wieder einmal in den Wolken versteckt. Netterweise fährt uns der Chauffeur noch ein paar Kilometer weiter zu einer Plantage, mit verschiedenen Anbauten, wie Bananen, tropischen Blumen und Pflanzen. Doch wie kommen wir zurück zur Hauptstrasse, den Berg hinunter und wieder hinauf mit zwei kleinen Kindern? Wir versuchen auf dem Parkplatz eine Mitfahrgelegenheit zu finden, leider ohne Erfolg. So machen wir uns guten Mutes auf den Weg. Tatsächlich nimmt uns schon nach wenigen hundert Metern ein voller kleiner Privatbus bis zur Hauptstrasse mit, in dem wir gerade noch knapp Platz finden. Von dort reisen wir weiter mit dem Maxi-Taxi nach Saint-Pierre.
Da in St. Lucia der Karneval kurzerhand auf den Juni verschoben worden ist und der Umzug zum Freiheitstag wegen heftigen Regenfällen abgesagt worden ist, geniessen wir in Fort de France einen Karneval in übervollen Strassen mit zu Soca (Musikstil) tanzenden und lärmenden Menschen in einfachen, phantasievollen Kostümen. Besonders fallen alte, rostige Autos auf (wenn man dem noch so sagen darf), die fantasievoll, meist obszön geschmückt, rauchend und lärmend durch die Strassen dröhnen, mit einer Schar johlenden Burschen im und auf den Autos. Uns gefällt das ausgelassene Treiben und wir geniessen an Strassenständen die einfache, gute kreolische Küche.
Saint-Pierre war die erste französiche Siedlung auf Martinique. Es hatte Anfang des 20. Jahrhunderts 29’000 Einwohner und war kulturell und ökonomisch so entwickelt, dass es als das „Paris Westindiens“ galt. Im April 1902 fing Mt. Pelé an Funken und Rauch zu speien, im Mai 1902 raste eine feurige Gaswolke den Hang hinunter über St. Pierre hinweg. Es blieb nicht viel übrig, ein einziger Mensch überlebte. Er war der einzige Sträfling im Gefängnis und von den dicken Mauern vor dem Feuertod geschützt. Ein einziges Schiff entkam schwer beschädigt der Katastrophe und schaffte es nach St. Lucia. Heute ist St. Pierre ein einfacher kleiner Ort, teilweise zeugen noch Ruinen von der Katastrophe. Das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum liegt in Fort de France.
Nun, wir wollen wieder zurück in die Rodney Bay, unsere Ersatzteile sollten langsam eintreffen. Die Fahrt nach St. Lucia ist nass und ruppig. Ich werde seekrank, unerklärlich warum gerade zwischen Martinique und St. Lucia, nach vorheriger langen Törns. Zum Glück ist es nur ein kleiner Schlag nach St. Lucia, ich fühle mich erschöpft und müde.
Wieder St. Lucia
Unsere Ersatzteile für unseren Autopiloten sind immer noch nicht da. Zum Glück können wir auf die Hilfe aus der Schweiz zählen, sonst wäre alles noch langwieriger und komplizierter. So segeln wir ca. 2 Stunden südlich in die idyllische Marigot Bay. Noch ist sie sehr idyllisch, versteckt in einer kleinen Bucht hinter hohen Palmen, aber das Land rund um die Bucht ist zum Verkauf und zur Überbauung freigegeben.
Von hier aus erkunden wir mit 2 weiteren Seglerpaaren den südlichen Teil von St. Lucia per Bus. Die Busse bringen nur immer ca. 10 Meilen Fahrstrecke hinter sich. Nach diesen 10 Meilen wartet man wieder auf einen Bus, der die nächsten 10 Meilen unter die Räder nimmt. Prompt bleiben wir auf halben Weg zwischen Marigot Bay und Soufrière in der Mittagshitze stecken. Nach einer stündigen erfolglosen Wartezeit, beschliessen unsere Freunde mit einem im Bus kennengelernten freundlichen Rastaman eine Wanderung in die Hügel zu einem schönen Wasserfall zu unternehmen. Aber ohne Wasser und Essen und der Aussicht mit zwei kleinen Kindern auf den Schultern in der prallen Sonne zu wandern, verzichten Andi und ich auf den kühlenden Wasserfall und warten weiter auf einen Bus, der prompt nach nur 10 Minuten weiterer Wartezeit auftaucht. Damit wir nicht noch länger irgendwo hängenbleiben, vereinbaren wir mit dem Chauffeur einen Tagespreis von „nur“ 50 US$ Spezialpreis. Soufriére liegt sehr idyllisch zwischen den zwei berühmten, steil abfallenden Gipfel der Pitons. Leider ist Soufriére nicht mehr sehr beliebt zum ankern, da es aufdringliche Einheimische habe. Doch wir erleben ein aktives Touristenmanagement, dass an unserem Wohlbefinden interessiert ist und sich auf der Strasse nach unserer Zufriedenheit erkundigt. Unser “Privatchauffeur” bringt uns nach dem Besuch im botanischen Garten und beim aktiven Vulkan, der ausser zwei rauchenden Löchern nicht viel bietet, zu einem netten, kleinen, einheimischen Lokal. Das Essen schmeckt sehr gut, kreolischer Reis mit Lamm oder Poulet, gebratene Platanas (Bananen ohne Zuckergehalt, werden als Gemüse gegessen), Christophine und Süsskartoffeln.
Nach diesem feinem Essen warten wir auf unseren Chauffeur. Vergebens!! Nach beharrlichem Nachfragen bei seinen Kollegen, wird uns ausgerichtet, dass er uns nicht zurückbringen könne und ein “ganz netter” Kollege von ihm offeriert uns die Rückreise zum extra günstigen Preis von nur US$ 100!! Nun, das Buschtelefon unter den Chauffeuren funktioniert wirklich und meine Drohung, dass wir nicht einfach ein teures Taxi nehmen werden, sondern es Probleme gäbe via Touristoffice. Eine Familie einfach stehen zu lassen wäre ja der Gipfel der Unverschämtheit. Dies wurde wohl von Taxi zu Taxi übermittelt, bis der betreffende gefunden war. Lachend hat er uns empfangen und freundlichst zurückgeführt, sogar gratis noch den restlichen Kilometer steiler Strasse zum Dorf hoch und zur Marigot Bay hinunter!
Kindereien
Ich geniesse die Ruhe und Stille im Schiff, Andi ist mit Yanik am Strand, Fabien schläft. In aller Ruhe räume ich die Küche und den Salon auf, später beginne ich zu kochen. Ich höre das Dinghi zurückkommen. Plötzlich plärrt Yanik in voller Lautstärke los. Da ist was passiert, aber Andi ist ja dort. Nichts passiert, Yanik plärrt weiter, ich renne bestürzt hinaus. Andi ist mit dem Dinghi nochmals weg, Yanik steht auf der Badeplattform und ich finde heraus, dass sein Unterseeboot hineingefallen sei. (Er hatte zur Weihnacht ein wunderschönes, rotes Playmobil-U-Boot erhalten.)
Sofort ziehe ich mich nackt aus und setze zum hilfreichen Tauchsprung an. Oje, da ist ja heute alles voll Quallen um unsere Muscat. Macht nichts, für Dein U-Boot mach ich alles, mein lieber Yanik, aber wo zum Teufel ist es denn reingefallen? Es muss doch noch ein bisschen sichtbar sein, schliesslich sinkt ein U-Boot nicht wie ein Stein ab, oder? „Ja, Mami, da vorne schwimmt es doch!“ Ich sehe nichts, ausser zwei Laubblättern, die auf dem Wasser treiben. „Mami, spring!“ Ja, zum Teufel, doch wo ist das U-Boot reingefallen? „Spring Mami“, brüllt Yanik, „da vorne treibt mein U-Boot!“ Die Laubblätter! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich beruhige Yanik und versichere ihm, dass Papi die Laubblätter-U-Boote noch in aller Ruhe rausfischen könne. Dann ziehe ich mich wieder an. Die Segler verschwinden wieder in ihren Booten, was die wohl von unserer verrückten Familie denken?
Übrigens, wer erinnert sich noch an den Film von Dr. Doolittle? Dieser wurde in der Marigot Bay gedreht.
Ausklarieren in St. Lucia
Endlich sind unsere Ersatzteile da. Wir segeln zurück nach Rodney Bay. Alles passt ausgezeichnet und wir sind glücklich über unseren gut funktionierenden Autopiloten. Für unsere kleine Crew ist er für längere Strecken unverzichtbar. Nun sind wir für die Weiterreise bereit, doch noch ein administratives Ungeschick haben wir zu lösen. Bei einem Apéro vor drei Wochen hat ein Segler gejammert, dass er festgestellt habe, dass sein Visum nicht wie üblich 3 Monate gültig wäre und er dies jetzt erst beim Ausklarieren bemerkt habe. „Wie nicht 3 Monate gültig, dies ist doch automatisch der Fall?!“ Nicht in Rodney Bay! Eine harmlose Frage wie z.B.: „Was denken sie, bis wann sind Ihre Ersatzteile da?“ und schon sind 3 Wochen gestempelt, ohne weitere Worte. Wir kontrollieren sofort unsere Visen und können tatsächlich das vorher für eine unleserlich gehaltene Unterschrift als Datum entziffern. Natürlich schon abgelaufen! Was tun? Unsere Ersatzteile waren nach St. Lucia bestellt, schwarz waren wir jetzt sowieso da und wenn sie uns ausweisen würden, wird es kompliziert. So kam es, dass wir 5 Wochen ohne gültiges Visum in St. Lucia sind. Was könnte uns passieren? Eine saftige Busse, ein Verfahren oder die sofortige Abreise? Wir überlegen, wie wir am besten das Herz des Beamten erweichen können. So gehe ich mit den zwei kleinen Kindern ganz nett zum Officer und schildere ihm unser Missgeschick. Er hat grosses Verständnis und wir können am nächsten Tag ohne Probleme ausklarieren. Wir sind sehr erleichtert. Später hören wir, dass die anderen Segler nach Castries in den Hauptort fahren mussten, dies mit Aufwand, doch ohne grössere Probleme regeln konnten.
Martinique-St. Lucia- St. Vincent – Grenadinen
Wieder segeln wir nach Martinique, holen unseren Besuch (Andis Mutter Margrit und Neffe Severin) ab und segeln nach einer schönen zweiten Inselrundfahrt mit dem Mietauto bei gutem Wetterbericht, aber mit ruppiger See zurück in die ruhige Marigot Bay auf St. Lucia. Wir baden den ganzen Tag, so sind alle Kinder müde und schlafen bei der nächsten Inselpassage nachts gut. Obwohl auf diesen Inseln ein gleichmässiger östlicher Passatwind bläst, sind die Passagen nicht immer ruhig. Der Wind wird zwischen den Inseln kanalisiert und erreicht leicht 40 Knoten, auch bei Wettervorhersage mit nur 10-15 Knoten Wind. Dazu kommt noch eine kabbelige See, d.h. die Wellen kommen von allen Himmelsrichtungen, was das Schiff arg zum schaukeln bringen kann. Genau dies erfahren wir bei unserer nächsten Inselpassage nach St. Vincent. Wir segeln wieder nachts los. Bei fast keinem Wind auf der windabgewandten Seite von St. Lucia benötigen wir wieder einmal den Motor. Aber kaum auf offener See im Kanal haben wir bis zu 45 Knoten Wind. Zum Glück hatten wir wohlweislich schon die Segel gerefft (Segelfläche verkleinert). Trotzdem krängen wir stark bei Am-Wind-Kurs. Ich sitze äusserst bequem an die Rückwand gedrückt auf der Leeseite im Cockpit, abgesehen davon, dass die seitliche Cockpit-Scheibe um Haaresbreite an meinem Kopf vorbei ins Meer fliegt und der erneute Ausfall unseres Autopilotes eine nicht mehr abwendbare Patenthalse verursacht, bei der unser Verdeckgestänge verbogen wird. Wir sind froh, als wir in der Windabdeckung von St. Vincent ankommen, schliesslich möchten wir mit unsere Gästen wunderschöne Strände und Schnorchelreviere entdecken und geniessen und nicht Segelmeilen „bolzen“.
St. Vincent und die Grenadinen
Ein bisschen skeptisch kommen wir in St. Vincent an. Man hört ja viel und in St. Vincent werde gestohlen, die Menschen wären aufdringlich im Verkauf. Doch wir treffen hier sehr nette, aufgeschlossene und lachende Menschen. Es kommt uns nichts weg, wie übrigens auf allen Inseln. St. Vincent war bis 1783 ausschliesslich von den Kariben-Indianer bewohnt, die die Insel bis in dieses Jahr gegen die Eindringlinge von England, Frankreich und Spanien abwehren konnten. Heute ist St. Vincent wie St. Lucia ein eigenständiger Staat im britischen Commonwealth. Auch hier wird links gefahren, englisch gesprochen, die Währung ist East Caribbean Dollar, doch werden gerne US Dollars angenommen.
Wir legen in Wallilabu-Bay an. Es ist hier üblich, dass die Einheimischen die Heckleine an Land festmachen. Der Ankergrund ist sehr tief, so dass die Muscat nur mit Anker nicht genügend gesichert wäre. Ich geniesse mit Yanik einen kleinen Spaziergang in den kleinen idyllischen Ort. Einfache Holzhäuser auf Pfählen stehen im dichtesten Grün, Hühner gackern aufgeregt und es scheint der Waschtag des Dorfes zu sein. Die Frauen stehen im Flüsschen und waschen im Süsswasser. Hinter einem Bretterverschlag finde ich einen kleinen „Tante Emma“-Laden. Ich freue mich über das frische Brot und erfahre vom Inhaber, dass er im zweiten Weltkrieg für die Engländer in Europa war und wie ihm die hohen Schweizerberge, die er per Zug nach Italien passiert hatte, imponiert haben.
Natürlich lädt diese wunderschöne Insel zum Verweilen ein, doch ziehen wir am Nachmittag weiter, nach einem feinen Mittagessen und Ruhepause zu den Grenadinen. Unser Ziel mit unseren Gästen sind die wunderschönen Sandstrände und Schnorchelreviere der Grenadinen, wo wir mit den Kindern nach Herzenslust baden möchten, bevor die Ferien nur allzu schnell vorbei sind.
Grenadinen – Bequia
Gegen Süden wird die Landschaft trockener. Bequia, eine Insel der Grenadinen, südlich von St. Vincent und zu St. Vincent gehörend, hat zwar noch Wälder, aber im Vergleich zum überwältigenden Grün von der Hauptinsel St. Vincent scheint sie trocken. Die 6000 Einwohner leben vor allem von der Fischerei und dem Tourismus. Sie gelten als die besten Fischer in der Karibik. Auf der Nachbarinsel Petit Nevis liegt eine Walfischstation, die jedes Jahr Wale nach alter Tradition mit der Harpune aus offenen Booten schiesst. Dieses Jahr fingen sie ein Walbaby mit dem sie die Walmutter anlockten….
Bevor wir die letzten beschaulichen Seemeilen unter die Segel nehmen, verproviantieren wir uns mit frischen Früchten und Gemüsen und essen ein sehr gutes Abendessen im bekannten Restaurant Frangipani.
Tobago Cays
Neugierig erreichen wir nach einer traumhaften Übersegelung, wie man das ja auch so in der Karibik erwartet, das vielbeschriebene Tobago Cay Riff. In smaragdgrünem Wasser, umgeben von 4 kleinen Inseln mit weissem Sandstrand und einem fisch- und korrallenreichem Riff, lassen wir den Anker fallen. Wir liegen völlig ruhig auf 3 Meter tiefem Ankergrund inmitten von glasklarem Wasser. Die südpazifikmässigen Inseln laden zum spazieren ein, der Sand zum Burgen bauen und das Riff zum schnorcheln. Die Unterwasserwelt ist überwältigend. Zwar habe ich schon viel gehört und gesehen, aber es ist unbestritten eines der schönsten Erlebnisse dieser Reise. Tintenfische, Schildkröten, Riesenseeigel, bewohnte Riesenmuscheln, farbige, leuchtende, phosphorierende Rifffische, faszinierende Korallenformationen können wir auf nur geringer Tiefe mit dem Schnorchelzeug ausmachen. Eine neue Welt öffnet sich für uns. Ich bin fasziniert und überwältigt von der wunderbaren Farbenpracht und verweile Stunden mit Staunen.
Ich schnorchle über und um Felsen, Korallenwälder bis zum Riffrand und wieder zurück in seichte Gewässer. Da, ein grosser (ca. 1.20 m), brauner Fische taucht links auf und schwebt vor mir vorbei. Neugierig schaue ich ihn an, diese Augen, dieser Mund…?? Hier hat es doch keine Haie, oder??? Es hat!!!!!! Was tun??? Ich fühle mich ziemlich hilflos, nur mit Bikini bekleidet, langsam wie eine Schnecke im Vergleich zum Hai! Was habe ich schon gehört, was zu tun ist??? Ruhig bleiben, keine nervösen Bewegungen. Ok. Falls er angreife, mit dem Zeigefinger in sein Auge stechen!! Ha, Ha.. Wo ist bloss Andi geblieben? Ich verstecke mich hinter einem Felsen. Ah, Andi taucht auf. Er versteht mein mit dem Schnorchel ausgestossenen Wort „Hai“ sogar noch unter Wasser. „Toll“ findet er. „Zeig mal wo!“ Ne, danke, ohne mich, wo ist das Dinghi? Es scheint mir meilenweit weg, aber plötzlich ist es sehr einfach hinein zu klettern. Ich schaue mich um. Andi verabschiedet sich, er gehe nochmals nach dem Hai gucken!
Später erfahren wir, dass es sich um Ammenhaie handle, die für den Menschen, wie die meisten Haie, absolut harmlos wären. Natürlich, streicheln sollte man sie nicht gerade. Es ist auf jeden Fall niemanden ein gefährlicher Zwischenfall mit Haien auf den Tobago Cays bekannt, beide Seiten sind froh, wenn man sie in Ruhe lässt.
Leider vergeht hier die Zeit viel zu schnell, wie so üblich in den Ferien. Wir segeln mit unseren Gästen weiter und bringen sie wohlbehalten nach Union Island, von wo sie ein (Inselhüpfer-) Flugzeug innert Kürze wieder nach Martinique und von da aus in die Schweiz zurück bringt.
Grenada, Carriacou und Sandy Island
Wir segeln weiter nach zur Insel Carriacou, womit wir in den Staat Grenada einreisen. Vor Carriacou liegt Sandy Island, eine kleine Sandinsel mit Palmen und Riff. Ich kann es natürlich nicht mehr lassen und bewundere die Millionen Fische im Meer. Dies ist nicht übertrieben. Grosse Fischschwärme, sowie eine ganze Gruppe von Tintenfischen schwimmen rund um mich. Es scheint mir, die Schwärme sind so dicht, dass ich sie mit den Händen wegschaufeln müsste, um Durchgang zu erhalten. Das Wasser ist so klar, dass ich klare Sicht auf den Grund habe und nach einer grossen, leeren Conch-Muschel tauche. Stolz halte ich meinen Fund in den Händen, doch spedieren wir sie bald wieder ins Meer, da sie zu sehr stinkt.
Die Passage von Sandy Island nach Grenada habe es in sich, steht in unserem nautischem Reiseführer. Die Bezeichnung „Kick-em-Jenny“ gilt für die rauheste und unangenehmsten Stellen der Grenadinen. Was uns wohl erwartet, nach den harmlosen Kanalpassagen zwischen Martinique, St. Lucia und St. Vincent? Wir erreichen Grenada nach einem ruhigen, schönen Törn, während dem wir Zeit und Musse finden, Yanik und Fabien Bücher vorzulesen und zu singen.
Grenada ist ein unabhängiger Staat im Britischen Commonwealth, es wird mit EC bezahlt und die Sprache ist Englisch. Das „Gebirge“ von Grenada erstreckt sich von Küste zu Küste und hat „Gipfel“ von über 600 Meter. Die amerikanische Invasion von 1983 wurde weltweit beachtet und bereitete der sozialistischen Regierung von Maurice Bishop ein Ende. Nicht zuletzt wegen dieser und früheren Unruhen blieben die Touristen der Insel fern. Seither ist aber die politische Situation stabil und der Tourismus nimmt zu. Kein Wunder, Grenada hat viel zu bieten. Grenada ist vor allem für die Muskatnuss bekannt, stellt aber vieles mehr her, wie Zimt, Kakao, Bananen, etc. Herrliche Wälder laden zum wandern ein, es hat sogar einen „Gebirgssee“.
Wir erwarten Post in St. George’s, der Hauptstadt. Wir setzen unseren Anker in der Lagune und sind mit dem Dinghi innert 5 Minuten in der Stadt. Eine farbige, saubere Stadt im englischen Kolonialstil erwartet uns mit den freundlichsten Menschen. Unser Dinghi befestigen wir an der Hafenmauer, kein Wächter oder Privatklub ist nötig um sein Wiederfinden zu garantieren, toll. Wir spazieren für Stunden in dieser sympathischen Stadt herum, Hügel rauf und runter, bewundern die schönen grossen Häuser, die alten, teilweise falsch gehenden, nach Big-Ben klingenden Kirchen und die tolle Aussichten.
Leider war keine Post für uns in St. George’s, doch dieser kurze Eindruck von Grenada hat uns sehr gefallen.
Übersegeln Grenada-Trinidad
Die Zeit vergeht viel zu schnell, schon ist anfangs Mai! In Tobago erwarten uns in 3 Tagen Freunde, die mit uns nach Trinidad segeln möchten. Wir bereiten uns auf die letzte der grösseren Passagen vor. Wir wissen, dass wir von St. George’s nach Tobago keinen Halb-Wind oder Vor-dem-Wind-Kurs haben können, sondern die Höhe so gut als möglich halten müssen weil es eine starke Strömung nach West hat. Die Wetterprognose ist gut, Wind von Nord-Ost.
Punkt 0.00 Uhr laufen wir aus der Prickly-Bay mit Kurs Süd-Ost. Aber schon nach einer halben Stunde beschliessen wir, wegen starkem, seitlichem Wellengang und zuviel Abdrift umzukehren, der Insel entlang zu segeln und so mit einem besseren Winkel Tobago anzupeilen. Morgens um 10.00 Uhr umrunden wir das Nordkap, erreichen den Atlantik und segeln wieder auf SSE-Kurs (ca. 190 Grad). Die Wellen sind auf dem Atlantik wieder grösser, doch segeln wir bei schönem Wetter ruhig mit Am-Wind-Kurs. Es läuft schön, doch machen wir sehr wenig Kurs-über-Grund, d.h. wir kommen distanzmässig sehr langsam vorwärts. Dafür können wir uns fast normal auf und im Schiff bewegen, dies ist für Yanik und Fabien noch wichtiger als für uns. Sie holen Spielsachen aus der Kinderkoje zum vorlesen, singen und spielen. Schnell vergeht wieder ein ganzer Tag auf See und statt der geplanten 15 Stunden sind wir jetzt schon den zweiten Morgen auf See. Der angekündigte Nordost-Wind bleibt aus, wir fahren mit Ostwind. Es gefällt uns gut, wir geniessen es, doch kommen wir so niemals rechtzeitig in Tobago an! Schliesslich wollen wir ja nicht auf diesem Übersegler in Rente gehen und inzwischen erwarten uns unsere Gäste in Tobago. Was tun?? Anstatt weiter aufzukreuzen, beschliessen wir Kurs nach Trinidad zu nehmen. Wir funken mit Erfolg über das deutschsprechende Kontaktnetz „Hugo“ an vor Anker liegende Yachten in Tobago. Es klappt! Unser Gäste werden informiert und buchen sofort einen günstigen Inlandflug nach Trinidad.
Auch wir setzen schliesslich von Pelikanen und Fregattvögel begleitet am Abend des dritten Tages nach 36 Stunden Segelei den Anker vor Chaguaramas in Trinidad.
Trinidad
Konsterniert schauen wir in das Meerwasser: Braun, trüb, kein Vergleich zu den nördlichen Inseln. Eine laute, beleuchtete Bohrinsel liegt 100 Meter neben uns. Hunderte von Yachten liegen vor Anker, Tausende auf dem Trockendock. Nach den klaren Wasser und der Ruhe der letzten Wochen ein abrupter Wechsel.
Endlich können wir unsere Gäste Monika und Roman in die Arme schliessen. Wir bunkern noch Esswaren und fahren wieder los, “um die Ecke” (= ca. 1/2 Seemeile) in die Scotland Bay. Löwengebrüll begrüsst uns! Wie bitte, Löwengebrüll? Ungläubig schauen wir ans Land. Löwen gibt es in Afrika. Vielleicht wurden ein paar ausgesetzt? Ach, komm, es ist zwar ein mehr oder wenig geschütztes Gebiet, aber Raubtiere? Es läuft uns kalt den Rücken hinunter, wie gut können diese Tiere schwimmen?
Von anderen Yachten erfahren wir, dass es sich um das unglaublich laute und furchteinflössende Gebrüll von den kleinen Brüllaffen handelt. Mutiger erkunden wir die nähere Dschungelumgebung auf einem Pfad. Grosse blaue Schmetterlinge flattern um uns. Weit und breit kein Affe, keine Schlangen, keine Riesenleguane, höchstens ab und zu eine Fliege und Krabben. Auch im trüben Meerwasser scheint nichts Gefährliches zu schwimmen und sauber zu sein. Die Trübung stammt vom Orinocodelta südlich von Trinidad und vom Moorboden. So geniessen wir auch ohne weissen, palmengesäumten Sandstrand unser Badevergnügen, umgeben von zwitschernden Vögel, zirpenden Insekten und brüllenden Affen.
Lepra-Station Chacachacare
Zwei Inseln weiter Richtung Westen liegt die Insel Chacachacare auf der wir die verlassene Leprastation besuchen möchten. Als wir in die Bucht fahren, machen wir auf beiden Landseiten verlassene Häuser aus. Wir entscheiden uns, bei den 3 grossen vor Anker zu gehen. Monika, Roman, unsere Gäste und ich setzen mit dem Dinghi hinüber, Andi bleibt auf dem Schiff. Geisterhäuser im Urwald. Ein bisschen mulmig ist uns schon. Was uns wohl erwartet? Roman hält das Dinghi, bückt sich und schmeisst mit den Worten „Ah, da ist ja schon eine abgefallene Hand“ ein gekrümmtes Stück irgendwas in Handform vor uns ins Boot. Monika und mir verschlägt es die Sprache. Erst beim näher Hingucken entpuppt sich das grusige Ding als grünes, verschlammtes Korallenstück in Hühnerfussform.
Vorsichtig steigen wir einen Pfad hoch und betreten die Häuser. Nichts berühren, vorsichtig die Zimmer betreten, Treppen meiden, es könnte ja etwas einstürzen oder ein unerwünschtes Tier sich verstecken. Wir tasten uns auf einen Balkon hinaus im oberen Stockwerk und bewundern die wunderbare Rundsicht über die stille Bucht. Andere Segler betreten die Anlage und klären uns auf, das dies ein verlassenes Kloster sei, keineswegs die Leprastation. Diese liege gegenüber in der Bucht!! Ha Ha! Lach, lach. Wir hatten wohl zu viele Horrorfilme in unserem Leben geguckt!
Am nächsten Morgen besuchen wir die verlassenen Häuser der Leprastation. Wir legen an einem kleinen Strand an. Wieder umflattern uns grosse blaue Schmetterlinge. Ein vollausgerüsteter Generatorraum, natürlich am zerfallen und verrosten und eine kleine Holzkirche mit eingefallenem Boden erwarten uns am Strand. Das Spital mit Untersuchungs- und Röntgenraum, der Röntgenapparat sieht betriebsbereit aus, fertige Röntgenbilder von Füssen, Händen und Brustkorb liegen herum. In der Apotheke steht ein Wandgestellt, vollgefüllt mit Medikamenten, wie Pillen, Watte, Verbandsmaterial. Auf dem Boden verstreut sind Karteikarten, nicht wie anzunehmen wäre mit Daten vom vorletzten Jahrhundert, nein, von der zweiten Hälfte des letzten Jahrhundert, mit Daten von Personen, die heute um die 40 Jahre alt sind. Arzt- und Untersuchungsberichte, Bücher, leider aber ist alles am verrotten. Einfach alles stehen und liegengelassen. Schade, dass niemand aufräumt und ein interessantes Museum draus macht. Zu guter Letzt sitzen am Ende des Pfades auf einem Baum eine Horde schwarzer Geier, die erschreckt hochflattern, als sie uns entdecken. Beeindruckt kehren wir zurück zu unserem Dinghi.